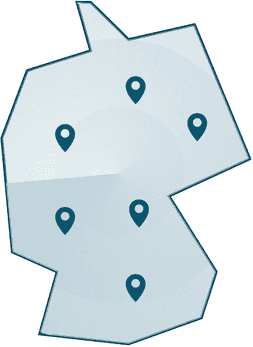Wie GaLaBau-Betriebe ihre Wirtschaftlichkeit steuern können
Viele GaLaBau-Betriebe kalkulieren ihre Preise noch immer eher nach Gefühl als auf Grundlage belastbarer Zahlen. Dabei gewinnt die betriebswirtschaftliche Steuerung über Plankosten zunehmend an Bedeutung – gerade in einem Markt, der wieder stärker über den Preis entscheidet. Warum sich Betriebe mit der eigenen Kostenstruktur auseinandersetzen sollten, welche typischen Fehler beim Einstieg zu vermeiden sind und wie Plankosten langfristig zur Stabilität beitragen können, erklärt Alexander Braun, Consulting beim Softwareunternehmen für den GaLaBau Dataflor, im Gespräch mit B_I galabau.

Warum sollten sich GaLaBau-Betriebe heute intensiver mit Plankosten beschäftigen?
Alexander Braun: Generell ist es sinnvoll sich zunächst überhaupt mal mit dem Thema Plankosten zu beschäftigen. Wir sehen im Alltag leider immer noch, dass sich die deutliche Mehrheit der GaLaBau Betriebe gar nicht mit der Thematik auseinandersetzt und Preisgestaltungen für Arbeiten oft eher Schätzungen sind als tatsächliche Vorkalkulationen.
Ein Grund dafür könnte sein, dass die meisten Betriebe seit den 2000er Jahren einen Markt vor sich hatten, in dem nicht wirklich über den Preis diskutiert wurde. Die Investitionsbereitschaft war generell über alle Zielgruppen hoch und die Frage lautete eher, wann angefangen werden kann zu arbeiten. Das hat sich in der näheren Vergangenheit gedreht und der Markt wurde preissensibler. Der GaLaBau sieht sich daher seit geraumer Zeit wieder mit der Problematik konfrontiert, bei welchem Preis die eigene „Schmerzgrenze“ liegt. Eine Gewinnschwelle kann allerdings nur kalkuliert werden, wenn ein Betrieb seine eigene Kosten- und Erlösrechnung im Griff hat und die Kennziffern erstens bekannt sind und zweitens auch im Alltag für Entscheidungen genutzt werden.
Welche praktischen Vorteile bietet eine Plankostenrechnung gegenüber der reinen Nachkalkulation?
Braun: Plankostenrechnung und Nachkalkulation befassen sich thematisch zunächst ja mit zwei unterschiedlichen Mechanismen des betriebswirtschaftlichen Controllings. Die Plankosten adressieren die Strategie. Die Nachkalkulation wertet die operative Seite aus. Beide Betrachtungswinkel eines Unternehmens sind wichtig, da sich der eine Bereich immer auch auf den anderen auswirkt.
In der Nachkalkulation wird jedoch lediglich ausgewertet, wie eine Baustelle gelaufen ist. Also salopp gesagt, ob wir Geld verdient haben oder eben nicht. Die Plankosten legen im Gegensatz dazu die Rahmenbedingungen der Kalkulation fest. Wenn ein Betrieb beispielsweise seine laufenden Verwaltungskosten nicht kennt, kann die Nachkalkulation auch nicht ermitteln, ob ein Gewinn übriggeblieben ist. Sie weiß schlichtweg nicht, wie hoch der Anteil an den Verwaltungskosten war, den diese spezifische Baustelle im Büro hätte abliefern müssen.
Um also eine aussagekräftige und belastbare Nachkalkulation durchzuführen, ist das aus einer Plankostenrechnung erlangte Wissen über den eigenen Betrieb daher von essentieller Bedeutung.
Wie lassen sich im GaLaBau realistische Planwerte für Arbeitsstunden und Maschineneinsatz bestimmen?
Braun: Durch Ehrlichkeit! Speziell beim Punkt Produktivität – egal ob bei Arbeitsstunden oder Maschineneinsätzen – sind Betriebe oft zu optimistisch. Ein wirksamer Mechanismus wäre eine korrekt geführte Dokumentation verschiedener Lohnarten über den Tag. Betriebe, die Rüst-, Fahrt- und Produktivzeiten differenziert tracken, haben hier leichtes Spiel.
Bei den Maschinenstunden sieht das Ganze etwas komplexer aus. Zwar hat heutzutage so gut wie jedes Leistungsgerät einen Stundenzähler, aber auch der spiegelt nur die „halbe Wahrheit“ wider. Die Stundenzähler erfassen nämlich in der Regel nur, wie lange die Maschine gelaufen ist und nicht wie lange sie tatsächlich produktiv gearbeitet hat. Wenn beispielsweise der Bagger morgens im Winter schon angemacht wurde, damit eine halbe Stunde später die Kanzel bereits gemütlich beheizt wurde, kommen für solche oder ähnliche Fälle aufs Jahr gesehen teils erhebliche Differenzen zustande. Daher rechnen wir in den Plankosten normalerweise nicht ausschließlich mit den Zuwächsen der Zähleruhr, sondern veranschlagen einen gewissen Abzug für solche Leerläufe.
Über Dataflor
Dataflor entwickelt Softwarelösungen für Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus – vom kleinen Handwerksunternehmen bis zum mittelständischen Betrieb. Ziel ist es, Unternehmen der Grünen Branche bei der digitalen Organisation und Steuerung ihrer Arbeitsprozesse zu unterstützen. Dabei steht der praktische Nutzen für die Anwender im Vordergrund: Effiziente Abläufe, transparente Kalkulationen und verlässliche Daten sollen helfen, betriebliche Entscheidungen fundierter zu treffen. Gemeinsam mit den Anwendern arbeitet Dataflor daran, die Chancen der Digitalisierung im GaLaBau nutzbar zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche langfristig zu stärken.
Welche Rolle spielt die Erfassung von Gemein- und Gerätekosten bei der Planung?
Wo liegen die größten Fehlerquellen beim Einstieg in die Plankostenrechnung?
Braun: Der größte Fehler beim Einstieg ist nicht einzusteigen. Denn die Erstellung einer Plankostenrechnung ist keine höhere Raketenwissenschaft. Zugegeben, ein gewisses betriebswirtschaftliches und kaufmännisches Know-How ist notwendig. Dieses lässt sich jedoch erarbeiten und wird oft bei den beratenden Stellen während der gemeinsamen Erstellung einer Plankostenrechnung parallel vermittelt. Betriebe, die über mehrere Jahre hinweg sich kontinuierlich mit der Thematik beschäftigen, bauen über die Zeit ein tiefergehendes Verständnis für den eigenen Erfolg oder Misserfolg auf und verstehen, warum es gut oder schlecht gelaufen ist.
Wie häufig sollte eine Plankostenrechnung überpr�üft und angepasst werden?
Braun: Das ist eine der Fragen, die mir von Kundinnen und Kunden mitunter am häufigsten gestellt wird. „Wann soll ich wieder an meine Plankostenrechnung ran?“ Der Gedanke lässt sich auch anders formulieren. Nämlich nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt es zu tun, sondern wann wäre der falsche Zeitpunkt es lassen? Eine regelmäßige Aktualisierung zum Jahreswechsel ist zwar definitiv ein guter Ansatz und für das kommende Jahr kann die Finanzbuchhaltung des Vorjahres aktuelle Werte als Grundlage einer neuen Planung liefern. Wenn in einem laufenden Planungsjahr allerdings kostenwirksame Änderungen im Betrieb stattgefunden haben, dann wäre aus meiner Sicht der falsche Zeitpunkt, um eine aktuell gültige Planung nicht anzupassen. Eine solche Änderung wäre beispielsweise das Schwinden von Arbeitskraft. Ein solcher Verlust wirkt sich abhängig von der Größe in der Regel erheblich auf den Verkaufswert einer Stunde aus und gehört angepasst.
Welche Kennzahlen eignen sich besonders gut zur Steuerung der betrieblichen Leistung?
Braun: Früher waren die Wertschöpfung pro Stunde oder der Fixkostenfaktor in Prozent vom Umsatz oft genutzte Kennziffern. Mittlerweile gilt der Deckungsbeitrag pro Stunde eigentlich als aussagekräftiger. Der Soll-Deckungsbeitrag pro Stunde ist der Betrag, den jede produktiv auf der Baustelle geleistete Stunde zur Deckung der Verwaltungskosten „im Büro abliefern“ muss und stellt die Gewinnschwelle dar. Der Ziel-Deckungsbeitrag/Stunde beinhaltet dann zusätzlich den geplanten Gewinn des Unternehmens.
Da wir beim Deckungsbeitrag pro Stunde eine Relation zum Faktor Zeit und nicht zum Umsatz herstellen, kann jede Leistung mit jeder anderen Leistung verglichen werden. Denn gebaut wird immer mit Menschen. Und bei Menschen werden Zeiten für das Unternehmen eingekauft. Daher macht es meiner Meinung nach viel mehr Sinn, den Faktor als Relation heranzuziehen, der einen Betrieb am meisten limitiert: die maximale Anzahl an verkaufbaren Stunden.
Wie wirken sich saisonale Schwankungen und wetterbedingte Ausfälle auf die Planwerte aus?
Braun: Auf eine gesamte Planung für ein Jahr meist gar nicht. In der Branche ist ein Jahresarbeitszeitkonto gängige Praxis und ob ich im Sommer von meinen Mitarbeitenden mehr Arbeitszeit bekomme oder im Winter weniger geleistet wird, macht in der Jahressumme keinen Unterschied. Produktivität wird lediglich auf der zeitlichen Achse verschoben. Im Sommer füllen sich die Arbeitszeitkonten, während sie sich in der dunklen oder nassen Zeit wieder lehren. Vergütet wird eh meist ein verstetigter Monatslohn. Es wird nur im Sommer mehr geschafft als im Winter.
Welche organisatorischen Voraussetzungen braucht ein Betrieb, um Plankosten effektiv zu nutzen?
Braun: Organisatorisch hat jeder Betrieb alle Voraussetzungen allein dadurch erfüllt, dass eine Finanzbuchhaltung stattfindet. Alle Daten, die für die Erarbeitung einer Plankostenrechnung zwingend notwendig sind, finden sich in der Finanzbuchhaltung. Darüber hinaus sind zwar einige weitere Punkte für eine Erstellung sinnvoll zu nutzen, doch ist all dies ebenfalls Wissen, was in den Betrieben auf jeden Fall vorhanden ist. Ob ein Bagger gekauft, gemietet oder geleast wurde, oder ob meine Mitarbeitenden eine halbe oder eher eine volle Stunde zur Baustelle fahren, sollten Betriebe eigentlich wissen.

Wie kann die Plankostenrechnung langfristig zur wirtschaftlichen Stabilität eines GaLaBau-Betriebs beitragen?
Braun: Betriebe, die sich ihrer eigenen Kostenrechnung bewusst sind, treffen oftmals bessere Entscheidungen. Entscheidungen, die eh zum alltäglichen Geschäft gehören, werden weniger aus dem reinen Bauchgefühlt getroffen, sondern oft zuvor „finanzmathematisch“ dargestellt und es zeigen sich Türen. Ob Tür eins oder Tür zwei gewählt wird, bleibt letztendlich die unternehmerische Entscheidung, für die auch ein gutes Bauchgefühl oder Erfahrung nicht schädlich ist.
Als Feedback von Kundinnen und Kunden, die das Thema Plankosten angegangen sind, kommt häufig, dass sie sich ihrer Sache mittlerweile sicherer sind. Preisvorteile werden mitunter weniger oder in kleinerem Maße eingeräumt. Oft werden althergebrachte Methoden wieder hinterfragt oder Investitionen erhalten z.B. einen anderen Maßstab. Ob ich als Entscheidungsgröße eine Ausgabe von 50.000€ als Einzelwert heranziehe, oder heruntergebrochen auf eine verkaufte Stunde von einer Preiserhöhung von 50 Cent rede, konnotiert diese Erwägung maßgeblich.
Messbar werden in Plankostenrechnungen getroffene Annahmen und Entscheidungen kurzfristig, wenn wir innerhalb von zwei Jahren eine Veränderung bemerken. Ist keine Änderung zu sehen, dann hatte die Maßnahme auch keine Wirkung oder sie wurde nicht konsequent im Alltag umgesetzt. Es geht in der langfristigen Annahme, wohin sich ein Unternehmen entwickeln möchte aus meiner Sicht immer darum, kurzfristige, umsetzbare Änderungen zu planen, die durch das Erreichen des Ziels Lust auf mehr machen.
Gedeiht die grüne Branche?
Aktuelle Nachrichten zu den Entwicklungen im GaLa-Bau erfahren Sie in unserem Newsletter.
Hier abonnieren!
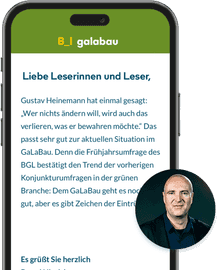
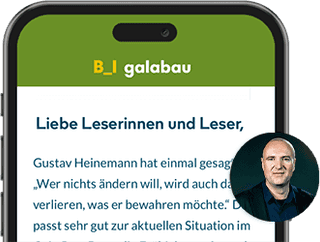
Und zu guter Letzt ist es nie verkehrt, seine eigene Leistung nicht unter dessen Wert zu verkaufen. Den tatsächlichen Wert der eigenen Arbeiten zu kennen ist nicht selten singulär betrachtet schon eine Offenbarung.
Vielen Dank für das Gespräch
Neueste Beiträge:
Meistgelesene Artikel
Jetzt Ausschreibungen finden
Wählen Sie eine Leistungsart, die Sie interessiert.


Bau


Dienstleistung
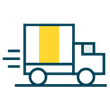

Lieferung
Verwandte Bau-Stichworte:
Top Bau-Stichworte:
Jetzt zum Newsletter anmelden:
Werden Sie Experte im Garten- und Landschaftsbau. Plus: Kommunaltechnik.