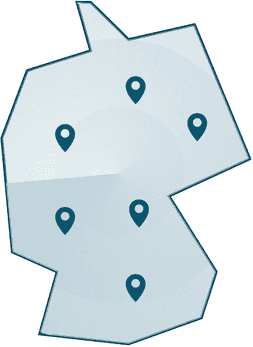So klappt es mit dem Bad im Schwimmteich oder Naturpool
Noch bevor es in die Überlegungen und wichtigen Details für diese Variante des Schwimmens geht, zunächst ein paar inspirierende und motivierende Gedanken für das Bad im Freien im gesammelten Regenwasser. Denn ist es nicht weit mehr als ein schöner und verlockender Gedanke, in Wasser zu schwimmen, das sich fast genauso anfühlt wie jenes im dörflichen Weiher der Erinnerung oder dem kleinen Tümpel auf der Lichtung.

Dieser besonders pragmatische Ansatz hat dazu geführt, dass die Wasseranlagen Schritt für Schritt mit jedem Schauer oder Landregen ein zusätzliches Plus an schwer vorherzusagendem stofflichem Eintrag erhalten haben, während überschüssiges Wasser aus dem Teich selbst in die Vorflut weiterfließt und unkontrolliertes Über-die-Ufer-treten keinen Schaden in der Umgebung oder dem Teich selbst anrichtet. In solchen Fällen wäscht entweder Niederschlag wunderbar die Wassersammelflächen ab und verfrachtet alle angelandeten Stoffe mit in den Teich – je größer also die Sammelfläche, desto mehr Regenwasser ist zum Nachfüllen verfügbar. Aber parallel dazu steigt der Eintrag zuvor angesammelter Stoffe.
Oder im Fall von ungeregelter einfacher Zuleitung von Niederschlag erfolgt die zusätzliche Verdünnung in der stofflichen Zusammensetzung des zuvor gut entwickelten und stabilen Teichwassers. Zudem sorgt der stoffliche Eintrag über Sammelflächen für weiteres Ungemach im Unterhalt von Schwimmteich oder Naturpool auf lange Sicht. Aus diesem Grund bezieht das maßgebliche Regelwerk klare Stellung dazu.
Regenwasser für Schwimmteich und Naturpool: Ein Blick ins Regelwerk
Der Autor
Maximilian Colditz ist Landschaftsarchitekt, Lehrbeauftragter an der Hochschule Osnabrück, Schwimmteich-Experte und leitet die OASE-Academy. Er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (DGfnB) wie auch der International Organisation for natural bathing waters (IOB). Die OASE-Gruppe ist einer der führenden international agierenden Spezialisten für die Inszenierung und Behandlung von Wasser im privaten und öffentlichen Bereich. Das Unternehmen mit Stammsitz im nordrhein-westfälischen Hörstel ist in den Bereichen Wasser im Garten, Aquaristik, Fountain und Water Technology aktiv.
Die Richtlinie der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) berücksichtigt bereits seit langem die Möglichkeit, Schwimmteiche und Naturpools mit Regenwasser zu betreiben und auch zu speisen. Einzig ausgeschlossen ist die direkte und unmittelbare Zuleitung von anfallendem Regenwasser auf Flächen im Umfeld.
Vor der Wasserzufuhr ins Schwimmbecken muss immer die Abreinigung mitgeschwemmter Partikel erfolgen. Möglichkeiten zum Partikelfang bieten sich zum einen über Absetzbehälter und jährliches Absaugen des Sammelgutes als Dienstleistung oder zum anderen mit verschiedenen Arten der mechanischen Abscheidung und Filtrierung. In solchen Fällen ist die Kombination mit einem Zwischenspeicher für das Regenwasser vorteilhaft.
So kann das Gemisch zunächst ungehindert dem Speicher zufließen und vereinfacht die Dimensionierung des Filtersystems, das im kleinen Kreislaufbetrieb die zugeführten Partikel aufnimmt anstelle einer Filtereinheit für den Einmaldurchsatz im Zulauf. Dann ist die Dimensionierung auf Basis des maximalen Zufluss-Ereignisses notwendig, um Rückstau zu vermeiden. Ein weiteres gravierendes Kriterium laut Richtlinie ist die Materialbeschaffenheit der Sammelflächen als auch der Zuleitung(en). Es muss sichergestellt sein, dass sich keinerlei Schadstoffe lösen können und im Speicher ankommen.
Andernfalls können Schwermetalle wie Kupfer und Blei oder biozide und algizide Imprägnierungen ihre Wirkung in Schwimmteich oder Naturpool entfalten. Im schlechtesten Fall hemmen sie die erforderliche Leistungsfähigkeit der natürlichen Prozesse erheblich.
Chancen aus Betriebssicht für den Einsatz von Regenwasser
Passend zu den obigen Kriterien eingesammeltes und gespeichertes Wasser bietet über die offensichtliche Ersparnis von Trink- oder Grundwasser hinaus Vorteile im Dauerbetrieb und bei Betrachtung der jährlichen Aufwendungen und/oder Kosten:
- Ersparnis der Gebühren im Fall bisheriger Trinkwassernutzung
- Umdenken im Betrieb: von Entnahme überschüssiger Ionen zu bedarfs- und zielgerechter Zugabe
- Perspektivische Betriebssicherheit in Perioden der Nutzungsbeschränkung für Grund- oder Trinkwasser in Gärten
- Wasserspeicher für Besitzer im persönlichen Zugriff
- Nachrüstung bestehender Anlagen
Speichervolumen mit Schwimmteich oder Naturpool kombinieren

Optimale Grundlagenwerte können die Daten und Statistiken des Deutschen Wetterdienstes bereitstellen. Damit lassen sich sowohl die Prognosen für jährliche Niederschlagsmengen als auch Verdunstungsraten regional ableiten. In die Prognosen zur Verdunstungsrate sollen ergänzend die nachfolgend beschriebenen Aspekte zur Verdunstungsleistung einfließen. Wasserflächen mit ausgeprägter Bepflanzung sollten als Grünland mit entsprechender Wuchshöhe in die Dimensionierung und Projektion der Verdunstungsleistung einfließen.
Lassen örtliche Situation und Leitungsführung es zu, ist es sinnvoll, Überschüsse des direkten Niederschlags ins Schwimmbecken mit jenen von der externen Sammelfläche zu vereinen. So bleibt insbesondere das Wasser aus dem Naturpool für die Wiederverwendung erhalten.
Unterirdische Speicherung: Ein technisches Bauteil unterhalb der Sichtlinie bietet speziell für kleine Grundstücksflächen die Möglichkeit, das Reservoir zum Beispiel unter der Liegefläche am Schwimmbecken zu positionieren. So steht das Nachfüllwasser in Hitzeperioden erdgekühlt zur Verfügung. Mit Blick auf die Anforderungen zur Beschaffenheit des Wassers sollten Möglichkeiten zur Abreinigung von Ablagerungen am Boden des Speichers Grundvoraussetzung sein.
Oberirdische Speicherung: Ist ausreichend Fläche auf dem Grundstück vorhanden, bietet sich auch die Option eines Speicherteiches an. Er bietet zusätzliche naturnahe Lebensräume für Fauna und Flora. Aufgrund des Nutzungszwecks als Zwischenspeicher mit variierender Höhe des Wasserspiegels sollten Ufer- und Böschung bis zum Grund ausgestaltet sein, inklusive der Bepflanzung als auch Abdichtung, die saisonales Trockenfallen verkraften.
Wasserzufuhr zum Schwimmbecken: Für die Nachspeisung vom Speicher ins Schwimmbecken ist der Einsatz einer Pumpe die Regel. Für den Betrieb stellen sich zwei Optionen, zum einen mittels elektronischem Füllstandsensor und zum anderen mithilfe einer minimale Wasserzirkulation zwischen Becken und Behälter im geregelten Intervallbetrieb.
Stellschrauben zur Verdunstungsleistung einer Anlage
Wasseroberfläche: je größer die Oberfläche, umso größer die Verdunstungsleistung
Dieser Merksatz hat immer die tatsächliche Oberfläche des Wassers innerhalb der Anlage im Blick. Demgegenüber steht der ausschließliche Wasserspiegel als rein geometrische Oberfläche, die sich ausgehend vom Schwimmbedarf errechnet. Dazu sind pro Schwimmstoß und Schwimmer jeweils eineinhalb Meter Distanz und zwei Meter Breite bei mindestens 1,35 Metern Tiefe anzusetzen. Die so zustande gekommene Fläche bildet die Basis für den Bedarf an ergänzend erforderlicher Fläche und Volumen für die Einrichtungen zur biologischen Wasserreinigung. In der alltäglichen Praxis entspricht die so ermittelte Fläche also nur an den ausgewählten Tagen mit absoluter Windstille, null Wellenbewegung und ohne Infinity-Kante oder Ähnlichem der Realität. Das bedeutet, je mehr sich die tatsächlich während der Nutzung entstehende Wasseroberfläche vergrößert, desto größer die Verdunstungsleistung, egal ob dies als Wassertropfen, Welle, Wasserfall oder benetzender Wasserfilm geschieht. Damit verbindet sich immer die Auswirkung der Oberflächengeschwindigkeit zusammen mit der nun folgenden Bedeutung der Luftschicht(en).
Luftschicht unmittelbar an der Wasseroberfläche: je turbulenter, desto größer das Potential für die Verdunstungsleistung
Egal also, ob Wasser schnell fließt, plätschert oder fliegt, die konstante und stehende Luftschicht ist aufgelöst. Je nach zugedachter Aufgabe für die Wasseranlage insgesamt – entweder lokale Verdunstung fördern oder minimieren - kann dies Vor- oder Nachteile entfalten. Geht es um Wasserbewegung, lässt sich dies zum Beispiel über geregelten Intervallbetrieb den Anforderungen anpassen. Um Bedeutung und Wirksamkeit der Luftschicht als weiteren Aspekt zu verdeutlichen, hier als Beispiel der besonders heiße Mittlere Osten: Ist über dem Wasserspiegel eine konstante Luftschicht möglich, kann sich dort ein Sättigungsgleichgewicht etablieren. Das verringert die Verdunstungsleistung und sorgt gleichzeitig dafür, dass bei solchen Anlagen die Wassertemperatur niedriger ausfällt als bei solchen mit fehlender konstanter Schicht. Und genau daraus begründet sich, weshalb Infinity-Kanten für Schwimmteiche und Naturpools mit entsprechenden Maß und Zweckbezug zum Einsatz kommen sollten. Eine konstante Luftschicht ist aufgrund der umgebenden Kubaturen nicht gegeben.
Wasser-Bepflanzung: je größer die Blattoberfläche über Wasser, desto größer die Verdunstungsleistung
Auch für diesen Aspekt bieten Schwimmteiche und Naturpools dank der fünf verschiedenen Herstellungsarten Möglichkeiten zur verdunstungsfördernden oder verdunstungsreduzierenden Dimensionierung. Für errichtende Betriebe können sich damit Vorteile ergeben, das eigene Leistungsportfolio auf beide Bereiche auszulegen oder auf die regionale Bedingung im Einzugsgebiet anzupassen.
Umgebung: je besser der Schutz vor Wind und turbulenter Luftbewegung, desto geringer die Verdunstungsleistung
Regenwasserrückhalt von versiegelten Flächen

Lokale Wieder-Verdunstung
Insbesondere in baulich verdichteten Lagen und Wohngebieten lässt sich anhand von Satellitendaten feststellen, dass die Luftfeuchtigkeit im Vergleich zum Umland während Hitzeperioden unverhältnismäßig abnimmt. Das gilt bereits für Städte mit rund 300.000 Einwohnern wie zum Beispiel Münster. Aufgrund der Flächenversiegelung ist neben der Wasserspeicherung auch die Verdunstung oberflächennahen Bodenwassers unterbrochen. Damit wirken Hitzeperioden in solchen Gebieten sozusagen selbstverstärkend und die Bedeutung lokaler Wieder-Verdunstung nimmt weiter zu.
Niederschlagsspitzen abfedern
Um diesem Aspekt im Rahmen von naturnahen Badeanlagen nachzukommen, ist es erforderlich, Aufnahme und Speicherung von Niederschlag aus verdichteten Flächen in das Konzept zu integrieren.
Ein Schwimmteich oder Naturpool allein macht nicht den Unterschied im Verhältnis zur Größe der versiegelten Gesamtfläche im Bundesgebiet, aber in ihrer Summe kann diese Form der Badeanlagen einen inzwischen achtbaren Beitrag möglich machen. So geht die letztmalige Schätzung der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (DGfnB e.V.) für das Jahr 2021 von einer Jahresleistung mit rund 10.000 privaten Neuanlagen aus. Auch wenn sich dies aktuell über alle Marktsegmente und die verschiedenen Bauweisen verringert haben dürfte, entstehen weiterhin zahlreiche neue Objekte. Unter dem Strich bietet neben Neuanlagen auch die inzwischen vorhandene Vielzahl an Anlagen Chancen: das betrifft die zusätzliche Verbesserung der Betriebskosten im Bestand. Hier lässt sich darüber hinaus die Speicherdimensionierung mithilfe bereits vorhandener Verbrauchs- oder Erfahrungswerte passgenauer vornehmen. Dies erleichtert ebenso Aussagen für den Zeithorizont bis zur Amortisation eines hinzugefügten Regenwasserspeichers.
Zusammenfassung
Regenwasserspeicherung in Verbindung mit Schwimmteichen und Naturpools bietet Chancen für einen passenden Beitrag zum regionalen Wasserhaushalt, Nutzungssicherheit und Amortisation für Anlagenbesitzer sowie Projektpotential für Herstellung und Dienstleistung. Für den positiven Beitrag zum lokalen Wasserhaushalt ist die gesamtheitliche Betrachtung und gemeinsame Würdigung aller in diesem Beitrag begründeten Einflussfaktoren von Stoffeintrag über Luftschichtung bis Verdunstungsleistung erforderlich.
Quellen:
- BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde https://geoportal.bafg.de/
- Deutscher Wetterdienst https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwirtschaft/dokumentationen/isabel/deutschland_verdunstung_doku.html
- Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e.V. https://www.dgfnb.de
- DIN EN 16582-1:2015 Schwimmbäder für private Nutzung – Teil 1: Allgemeine Anforderungen einschließlich sicherheitstechnischer Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung
- DIN EN 17645:2022-11 Schwimmbäder für die private Nutzung - Umwelteinfluss von Schwimmbädern für die private Nutzung - Anforderungen an die Konstruktion und Benutzung, Prüfverfahren und Klassifizierung der Geräte und Funktionen; Deutsche Fassung
- FLL – Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., 2017, Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von privaten Schwimm- und Badeteichen
Gedeiht die grüne Branche?
Aktuelle Nachrichten zu den Entwicklungen im GaLa-Bau erfahren Sie in unserem Newsletter.
Hier abonnieren!
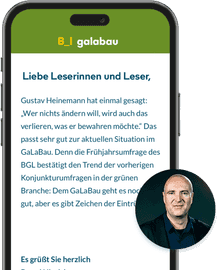
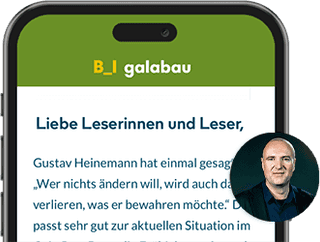
Lesen Sie auch:
Neueste Beiträge:
Meistgelesene Artikel
Jetzt Ausschreibungen finden
Wählen Sie eine Leistungsart, die Sie interessiert.


Bau


Dienstleistung
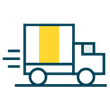

Lieferung
Top Bau-Stichworte:
Jetzt zum Newsletter anmelden:
Werden Sie Experte im Garten- und Landschaftsbau. Plus: Kommunaltechnik.